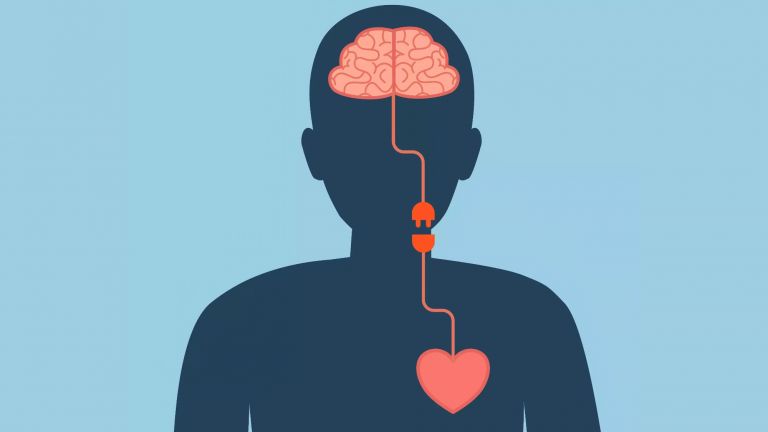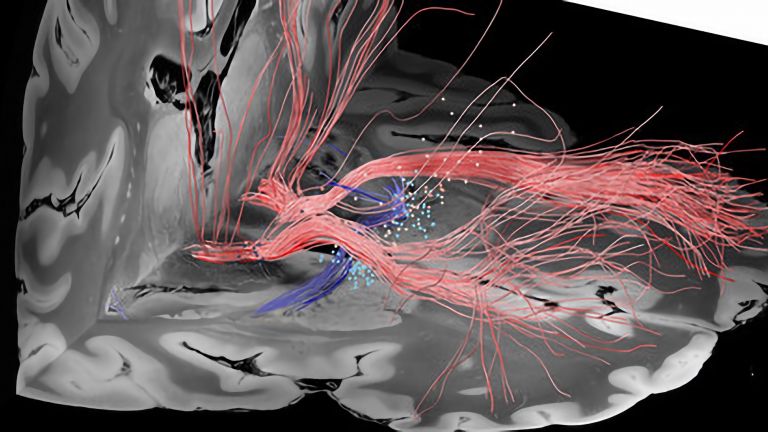Checklisten für seelische Leiden
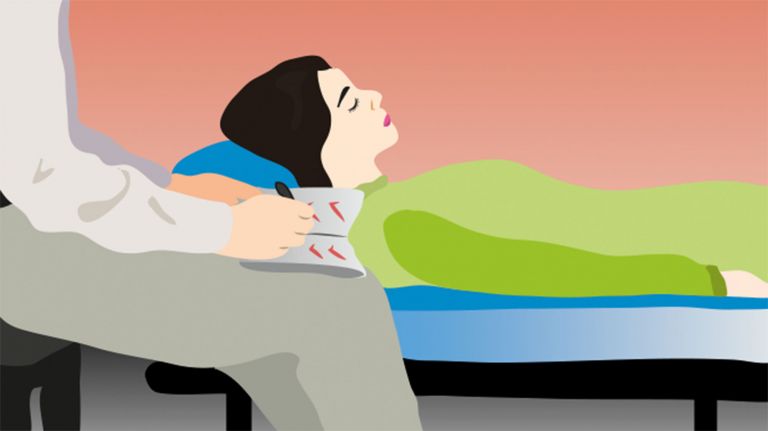
Sie setzen Standards in der Psychiatrie: Diagnosehandbücher geben Ärzten Checklisten an die Hand, um psychische Störungen verlässlich zu erkennen. Von Zeit zu Zeit müssen sie aktualisiert werden, was stets für Diskussionsstoff sorgt.
Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Andrea Schmitt
Veröffentlicht: 13.11.2013
Niveau: mittel
- Bis in die 1970er hinein waren psychiatrische Diagnosen oft geprägt von den fachlichen Vorlieben des jeweiligen Arztes.
- Mit dem Erscheinen des amerikanischen Diagnosehandbuchs DSM in seiner dritten Auflage wurde die Diagnostik standardisiert. Heute verwenden Psychiater Checklisten mit Symptomen, um eine Diagnose zu stellen.
- In Amerika ist das DSM mittlerweile zu einer unverzichtbaren Diagnosebibel für Psychiater geworden. In anderen Ländern wie Deutschland greift man hingegen auf die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten in der 10. Fassung (ICD-10) zurück.
- Neue wissenschaftliche Erkenntnisse werden in den Neuauflagen der Diagnosehandbücher berücksichtigt. Daher ändern sich mit jeder Auflage die Definitionen der Störungen, manche Erkrankungen kommen hinzu, andere werden wieder abgeschafft.
- Die Grenzen zwischen den Störungen sind häufig fließend. Daher sind die einzelnen Diagnoseschubladen bis zu einem gewissen Grad willkürlich.
- Bislang gibt es keine exakten Labortests, um eine Diagnose anhand von biologischen Auffälligkeiten im Gehirn oder in den Genen zu stellen.
Gen
Gen/-/gene
Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.
Es muss in den 1970ern äußerst frustrierend für Menschen mit psychischen Problemen gewesen sein: Ging man nacheinander zu drei verschiedenen Psychiatern, kam man nicht selten mit drei unterschiedlichen Diagnosen nach Hause. Je nachdem, welcher Schule und Lehrmeinung der jeweilige Experte anhing, lautete die Diagnose vielleicht bei dem ersten „depressive Neurose“, bei dem zweiten „Angstneurose“ und dem dritten „Anpassungsstörung oder hysterische Neurose“. Verbindliche Regeln für die Diagnose auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen – Fehlanzeige! Die Psychiatrie sei in dieser Zeit „eine reine Kunstform gewesen, manchmal brillant, meist schrullig, immer chaotisch“, schreibt der amerikanische Psychiater Allen Frances in seinem aktuellen Buch „Normal“.
1980 markierte dann den Wendepunkt. Die Standardisierung hielt Einzug in die Psychiatrie. Das amerikanische Handbuch zur Klassifizierung psychischer Störungen DSM (von: Diagnostic and Statistical Manual) der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung erschien in seiner dritten Auflage und brachte System in die Diagnostik. Denn es gab den Ärzten erstmals eine Liste von Kriterien an die Hand, um psychische Störungen einzuteilen.
Checkliste für psychische Krankheiten
Geht man heute zu einem Psychiater, kann er auf genaue Vorgaben und Checklisten zurückgreifen. Beim DSM etwa gibt er für eine Diagnose den Zustand des Patienten auf fünf „Achsen“ an. Bei der ersten dieser Achsen geht es beispielsweise darum, ob der Patient unter einer klinischen Störung wie etwa Schizophrenie oder Angststörung leidet. Vor 1980 wäre das, wie gesagt, eine Ermessenssache des Psychiaters gewesen. Heute klopft er den Patienten auf eine Reihe von Symptomen hin ab. Das DSM listet präzise auf, welche Symptome mit einer Störung einhergehen und wie viele davon über welchen Zeitraum auftreten müssen, damit die Diagnose gestellt werden kann.
Bei einer schweren depressiven Episode etwa muss der Patient fünf oder mehr Symptome wie Niedergeschlagenheit, Verlust des Interesses an der Umwelt oder Appetitlosigkeit an den Tag legen. Außerdem müssen diese Anzeichen einer Erkrankung gemeinsam mehr als zwei Wochen lang auftreten. Das alles reicht allerdings immer noch nicht für eine „handfeste“ Depression im psychiatrischen Sinn. Denn der Zustand des Patienten muss auch noch eine klinische Notlage oder Beeinträchtigung darstellen. Weitere „Achsen“ helfen bei der Einschätzung, ob körperliche Probleme vorliegen oder vielleicht eine Persönlichkeitsstörung.
In Amerika ist das DSM mittlerweile zu einer unverzichtbaren Diagnosebibel für Psychiater geworden. In anderen Ländern wie Deutschland greift man hingegen auf die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten (ICD) zurück, deren Vorgeschichte bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Die aktuelle 10. Fassung (ICD-10) beschäftigt sich im fünften Kapitel mit mentalen und Verhaltensstörungen. Die ICD wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben und ist in Deutschland rechtlich weitgehend verbindlich. In vielem orientiert sie sich am DSM.
Depression
Depression/-/depression
Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.
Nicht in Stein gemeißelt
Bis zu einem gewissen Grad kann man diese beiden wichtigsten Diagnosehandbücher mit Wörterbüchern vergleichen. Sie enthalten Definitionen und Konzepte zu seelischen Erkrankungen, die sich wie die Bedeutung von Wörtern auch einmal verändern können. Diagnosekataloge müssen an neue Erkenntnisse aus der Forschung angepasst werden. Für die im Mai 2013 erschienene fünfte Auflage des DSM (Was ist eigentlich noch normal?) mussten die beteiligten Forscher für zahlreiche Diagnosen Hunderte von Studien kritisch sichten und bewerten. Bei der Depression beispielsweise hatten viele Autoren die bisher gültige Definition einer Depression entweder als zu eng oder zu weit kritisiert. Andere schlugen neue Störungsbilder vor, wie etwa die gemischte Angst-Depression. Solche Kritik und Anregungen müssen die Wissenschaftler bei jeder Neuauflage kritisch prüfen.
Dies geschieht derzeit auch beim ICD. Im geplanten ICD-11 sollen beispielsweise die Schizophrenie und andere so genannte primäre Psychosen neu aufgeteilt werden. Die alten Subtypen wie beispielsweise die „paranoid-halluzinatorische“, die „hebephrene“ oder die „katatone Schizophrenie“ haben sich für die ärztliche Prognose nicht bewährt und sollen aufgegeben werden.
Man darf außerdem nicht vergessen: Das DSM und die ICD teilen psychische Störungen künstlich in kleine verdauliche Häppchen ein. Dabei werden nur die häufigsten Symptome einer Störung aufgelistet, die anderen fallen unter den Tisch. Das erhöht die Verlässlichkeit der Diagnosen. Ärzte und Psychiater kommen leichter zum gleichen Urteil. Gleichzeitig steht aber die Gültigkeit infrage.
Depression
Depression/-/depression
Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.
Empfohlene Artikel
Probleme mit den Schubladen
Die Frage ist, ob die Diagnosen der komplexen Wirklichkeit gerecht werden. Das DSM und das ICD gehen pragmatisch davon aus, dass man psychische Krankheiten voneinander abgrenzen und in einzelne Schubladen einsortieren kann. Doch was in der Theorie gut klingt, klappt in der Praxis nicht immer. So treffen die Kriterien der Handbücher auf viele Patienten nur bedingt zu. Andere Betroffene passen hingegen gleich in mehrere Diagnoseschubladen. In Wahrheit sind die Grenzen zwischen den Störungen häufig fließend. Depressive Symptome etwa können bei einer Depression, aber auch bei Schizophrenie auftreten. Und etwas wiegt vielleicht noch schwerer: Die Diagnosehandbücher teilen die einzelnen Erkrankungen lediglich anhand von Symptomen ein. Über die möglichen Ursachen schweigen sie sich bewusst aus.
Es fehlen Biomarker
Bei der Neuauflage des DSM verfolgte die Amerikanische Psychiatrische Vereinigung daher lange Zeit die ambitionierte Absicht, so genannte Biomarker aufzunehmen. Mittels solcher objektiv messbarer biologischer Anzeichen psychischer Erkrankungen erhoffte sie sich, in Zukunft eindeutige und objektive Diagnosen stellen zu können. Immerhin hatte man schließlich in den vergangenen Jahrzehnten eine ganz Reihe von strukturellen Auffälligkeiten im Gehirn oder Genvarianten bei einzelnen psychischen Störungen ausfindig gemacht.
Doch die Task Force „Biologische Marker“ des Weltverbands der Gesellschaften für biologische Psychiatrie kam zu dem Schluss, dass es bisher noch keine verlässlichen Marker für psychiatrische Erkrankungen gibt. Bislang ist es nicht möglich, mit Gentests, bildgebenden Verfahren oder anderen Tests psychische Erkrankungen von Normalität zu unterscheiden. Es gibt bis heute kein einziges biologisches Diagnoseverfahren – für keine einzige psychische Störung.
Bis auf weiteres werden also auch in Zukunft die Symptome im Zentrum der Diagnose stehen.
Biomarker
Biomarker/-/biomarker
In der Medizin versteht man unter einem Biomarker eine Substanz, die Hinweise auf den physiologischen Zustand eines Organismus gibt. Biomarker können entweder im Körper selbst entstehen oder chemische Verbindungen beschreiben, die Ärzte dem Körper zuführen, um an ihrem Schicksal bestimmte physiologische Funktionen zu testen. In Bezug auf die Alzheimer-Krankheit sind mehrere Indikatoren als mögliche Biomarker im Gespräch. Hierbei handelt es sich beispielsweise um die Konzentration an löslichem Amyloid-Vorläuferprotein im Blut sowie um die Aktivität des Enzyms, welches das Vorläuferprotein so zerschneidet, dass hieraus das plaquebildende Beta-Amyloid hervorgeht. Oft werden auch krankheitsbezogene Veränderungen, die mit bildgebenden Verfahren nachgewiesen werden, als Biomarker bezeichnet. So kann man zum Beispiel den Abbau von Gehirngewebe im MRT erkennen.
zum Weiterlesen:
Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien, h. von H. Dilling, W. Mombour und M.H. Schmidt, Bern 2011
- Anmelden oder Registieren, um Kommentare verfassen zu können