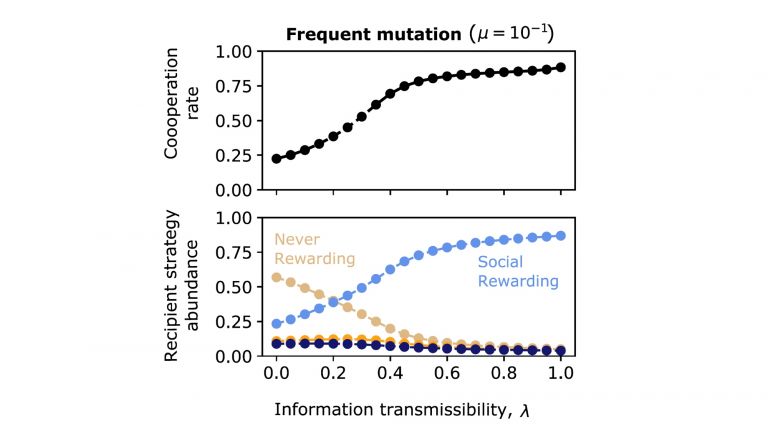„Das Regelwerk des Geistes ist im Genom eingeschrieben“

Der Sinn des Individuums ist die Verbreitung seiner Gene. Im Interview erklärt der Soziobiologe Eckart Voland, warum wir trotzdem zu sozialen Wesen wurden.
Veröffentlicht: 19.08.2016
Niveau: mittel
- Der Soziobiologie zufolge ist das Individuum darauf optimiert, seine Gene möglichst zahlreich an die nächste Generation weiterzugeben.
- Kooperation mit anderen kann eine Strategie sein, dieses Ziel zu erreichen. Ihre Entstehung gibt aber noch Rätsel auf.
- Individuen investieren zum Teil sehr viel, um einen geeigneten Partner für die Fortpflanzung zu finden. Dabei kann es zu Entwicklungen kommen, die ökologisch wenig sinnvoll zu sein scheinen.
- Die Soziobiologie legt viel Wert auf methodische Strenge.
- Die größten Herausforderungen finden Soziobiologen heute in der Erklärung höherer kognitiver Fähigkeiten wie dem Bewusstsein oder von Eigenschaften des sozialen Gehirns wie dem Gewissen.
Gen
Gen/-/gene
Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.
Eckart Voland ist emeritierter Professor für Philosophie der Biowissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Der studierte Biologe, Sozialwissenschaftler und Anthropologe ist einer der bekanntesten deutschen Forscher auf dem Gebiet der Evolution des Sozialverhaltens und Autor eines Standardwerks zur Soziobiologie.
Empfohlene Artikel
Herr Professor Voland, die Soziobiologie war in ihren Anfängen stark umstritten. Hat sich die Aufregung inzwischen gelegt?
Prof. Eckart Voland: Ich denke schon. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich in meinen ersten Vorlesungen immer sehr viel investieren musste, um die Studierenden zu überzeugen, dass ich kein böser Mensch bin, kein Rechtsradikaler, kein Populist, sondern einfach ein Wissenschaftler, der versucht, die evolutionären Grundlagen des Sozialverhaltens zu verstehen. Das ist heute nicht mehr nötig und ich denke, das hängt damit zusammen, dass die Soziobiologie viel Wissen mit hohem Erklärungswert für soziale Phänomene produziert hat.
Das Leben in Gesellschaften, Gemeinschaften und Familien fordert vom Einzelnen zahlreiche Kompromisse. Wie verträgt sich das mit der grundlegenden Annahme der Soziobiologie, letztendlich gehe es immer darum, möglichst viele eigene Gene in die nächste Genration zu bringen?
In vielen Fällen vergrößert Kooperation die Chance, sich selbst erfolgreich fortzupflanzen oder, wenn das nicht geht, nahe Verwandte dabei zu unterstützen. Wo aber Kooperation herkommt, vor allem in der Komplexität, wie wir sie beim Menschen sehen, ist in der Tat eins der ganz großen ungelösten Rätsel. Wir haben die Fähigkeit, in sehr großen Sozialverbänden zu leben, man spricht auch von Ultrasozialität. Doch Kooperation ist evolutionär nicht spontan stabil. Die beste Problemlösung für alle wird dann nicht erreicht, wenn der persönliche Vorteil des Einzelnen größer ist, sobald er eine egoistische Strategie wählt. Und das ist der Regelfall. Das haben die Soziologen schon früh mit dem Gefangenendilemma gezeigt. Es gibt nun in der Soziobiologie eine ganze Reihe von Modellen, die zu erklären versuchen, warum Menschen trotzdem kooperieren.
Gen
Gen/-/gene
Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.
Welche zum Beispiel?
Zum Beispiel die Verwandtenselektion, das Elterninvestment. Uneigennützigkeit als Angeberei gehört hier ebenso dazu wie Kooperation auf biologischen Märkten mit Gewinnen für Anbieter und Nachfrager. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass es eine enge Verbindung zwischen Funktion und Mechanismus gibt, dass sich also unsere Verhaltensweisen entwickelt haben, um Probleme des Überlebens und der Fortpflanzung zu lösen. Ob bei Menschen oder Tieren, aus evolutionärer Sicht geht es letztlich immer um den Nutzen, den ein Verhalten für das Verbreiten der Gene eines Individuums hat. Etwa wenn es um die Frage geht, ob ein Individuum seinen Nachwuchs eher durchbringt, wenn es sich alleine um ihn kümmert oder mit anderen kooperiert. Freilich muss dies von den Handelnden gar nicht so empfunden werden. Psychische Motive haben etwas zu tun – wie man so schön sagt – mit Lustvermehrung und Frustvermeidung und in der Selbstwahrnehmung nichts mit Genverbreitung. Es gibt nicht einmal einen Fortpflanzungstrieb – nur eine verhaltenswirksame Sexualität. Zu den ersten Herausforderungen evolutionären Denkens gehört die konsequente Unterscheidung von Funktion und Mechanismus. Zumindest, wenn es um Menschen geht, wird diese Unterscheidung erfahrungsgemäß nicht immer bereitwillig vollzogen. Missverständnisse sind die Folge.
Ist es nicht ein wenig einseitig, die Vielfalt des Lebens nur unter dem Aspekt der Verbreitung von Genen zu betrachten?
Ja, das wäre es wohl, wenn Soziobiologen einäugig bis blind für andere Fragen wären. Das sind sie aber natürlich nicht. Gleichwohl kann es keine umfassende Antwort auf die Frage nach den Ursachen menschlichen und tierlichen Sozialverhaltens geben, wenn diese die evolutionäre Sicht marginalisierte.
Wie lässt sich das Streben nach dem Erfolg der eigenen Gene nachweisen?
Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass das Leben von Stiefkindern im Mittelwert belasteter ist als das Leben von biologischen Kindern. In ihre Ausbildung wird weniger investiert. Sie werden weniger beobachtet und haben dadurch ein höheres Unfallrisiko. Aus irgendwelchen Gründen ertrinken etwa beim Badeurlaub Stiefkinder häufiger als leibliche Kinder. Im statistischen Mittel natürlich. Andere Studien kommen aber zu dem Ergebnis, dass Väter durchaus in die Kinder ihrer Partnerinnen aus erster Ehe investieren. Das erklärt man dann damit, dass der Mann sich bemühen muss, die Gunst der Frau zu gewinnen und zu erhalten. Und das tut er, indem er sich auch um Kinder kümmert, die nicht von ihm sind.
Zumal er sich ja nicht unbedingt sicher sein kann.
Das Thema Kuckuckskinder wird gerne hochgespielt. Dabei sind sie wahrscheinlich gar nicht so häufig, wie oft behauptet wird. Ihre Zahl liegt in den modernen, westlichen Gesellschaften vielleicht bei einem, sicher nicht über drei Prozent. Soziobiologisch lässt sich dennoch ein evolutionärer Effekt ausmachen: Männer können die Ähnlichkeit zwischen den Kindern ihrer Partnerin und sich selbst besser einschätzen als die Mütter. Das hat man in Studien herausgefunden, bei denen das eigene Bild der Väter mit dem von Kindern verschmolzen wurde. Von Studien aus Mexiko und den USA weiß man auch, dass nach einer Geburt meist die Verwandten der Mutter zuerst die Ähnlichkeit mit dem Vater feststellen. Vermutlich, um das evolutionäre Misstrauen, das bei den Vätern vorhanden sein könnte, abzubauen und die Investitionsbereitschaft des Vaters in das Kind zu steigern.
Gen
Gen/-/gene
Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.
Gen
Gen/-/gene
Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.
Aber heute spielt doch die biologische Familie eine immer geringere Rolle.
Natürlich gibt es auch Kooperationsbeziehungen, im besten Fall Freundschaften, mit Nicht-Verwandten. Aber in dem Moment, in dem unser Leben krisenhaft wird, durch Krankheit, Scheidung, Arbeitslosigkeit, ist nach wie vor die Herkunftsfamilie der Anker Nummer eins. Auch wenn man sich sonst nur zu Weihnachten sieht. Das kann eine nicht-evolutionär informierte Soziologie nicht so einfach erklären, da hilft nur der Rückgriff auf die Verwandtenselektion: Wir haben eben einen Mechanismus, der uns dazu bringt, in Krisenzeiten bei Verwandten Unterstützung zu suchen.
Spielt Verwandtschaft bei Pflanzen auch eine Rolle?
Wenn Samenkörner der Senfpflanze nebeneinander aufgehen, spüren die Wurzelzellen, dass sie Nachbarschaft haben. Und sie können erkennen, ob die Nachbarpflanze aus derselben Zelllinie kommt, ob es also eine Verwandte ist. Dementsprechend richten sie ihre Tendenzen zu Kooperation oder Konkurrenz aus.
Lebewesen kooperieren nicht nur, sie tun auch vieles, um sich vor anderen hervorzutun. Bisweilen ist es nicht leicht zu erkennen, wie das überlebensdienlich sein soll.
Oh ja, denken Sie nur an den Irischen Elch mit seinem mehr als 3,50 Meter breiten Geweih, an das Rad des Pfaus oder an die enorme Buntfärbung mancher tropischer Fische. Um diese Merkmale auszubilden, braucht ein Organismus sehr viel Energie, und dann behindern sie ihn auch noch oder machen ihn auffällig. Aber wenn die Weibchen nun einmal den Hirsch mit dem größten Geweih oder den Hahn mit den buntesten Federn bevorzugen, hätte das Männchen, das auf solche Merkmale verzichtet, keinen Fitnessvorteil. Deswegen geht der Trend immer weiter in eine Richtung, auch wenn das ökologisch gesehen vielleicht nicht so sinnvoll ist. Heute weiß man, dass diese Merkmale Signalfunktion haben, dass die Pfauen mit den buntesten Federn im Rad auch das beste Immunsystem haben und die gesündesten Küken zeugen. Also sind die Hennen gut beraten, gerade diese Hähne auszuwählen.
Man kann sich viele Erklärungen für den evolutionären Nutzen eines Merkmals vorstellen. Wie finden Sie heraus, welche nicht nur gut klingt, sondern auch richtig ist?
Die Soziobiologie ist eine Verhaltenswissenschaft, die großen Wert auf methodischen Rigorismus legt. Deswegen gehören zur akademischen Soziobiologie sehr viel Mathematik, Modellbildungen, strategische Planspiele. Eine nette Geschichte zu erzählen, reicht nicht. Man muss immer beweisen, dass eine evolutionäre Strategie unter Konkurrenzbedingungen anderen Strategien überlegen ist. Außerdem gibt es auch noch viele andere Faktoren, die man berücksichtigen muss, etwa die Gendrift, also zufällige Veränderungen in den Ausprägungen von Genen, die für den Verlauf der Evolution ebenfalls eine große und vielfach unterschätzte Rolle spielen. Deswegen treiben wir diesen hohen empirischen Aufwand.
Was ist heute der provokativste Aspekt der Soziobiologie?
In meinen Augen, dass wir uns auch in unseren mentalen Kapazitäten und Kompetenzen nicht aus der Evolution ausklammern können. Ich erlebe es nach wie vor häufig, dass soziobiologische Erklärungen für einfachere Verhaltensweisen akzeptiert werden, doch wenn es um Moral, Ästhetik und Bewusstsein geht, pochen viele auf die Autonomie des Geistes.
Gibt es die nicht?
Nein. Natürlich hat alles, was wir an mentalen Prozessen beobachten, eine ganz spezifische Entwicklungsgeschichte. Die Frage ist, nach welchen Regeln sie abläuft. Und soweit man das überhaupt versteht, nehmen wir an, dass die Regelhaftigkeit selbst biologisch evolviert ist. Das Regelwerk des Geistes ist letztlich im Genom eingeschrieben. Auch wenn längst nicht völlig klar ist, wie die Evolution höherer mentaler Prozesse zu erklären ist, insbesondere von Bewusstsein und Selbstbewusstsein.
Welche soziobiologische Frage beschäftigt Sie zurzeit am meisten?
Die Idee vom sozialen Gehirn hat eine Brisanz und Tragweite, die man noch nicht wirklich verstanden hat. Das soziale Gehirn bewirkt, dass wir eigentlich nie allein sind. Wir sind immer Teil eines wenig verstandenen Netzwerks verschiedener Gehirne. Wir haben immer etwas, das uns anleitet und beeinflusst. Was bedeutet das für Freiheit und Autonomie? Autonomie, Innengeleitetheit, ist ein schönes Konzept, aber was heißt das eigentlich genau? Eine Grenze zu ziehen zwischen mir und den anderen, ist extrem schwierig.
Nun könnte man argumentieren, das soziale Gehirn habe die Menschheit zur erfolgreichsten Spezies des Planeten gemacht. Warum ist es ein Problem für die Soziobiologie?
Wenn die Kooperationsbereitschaft sich so stark erweitert, wie wir das in Großgesellschaften sehen, zeigen sich möglicherweise Formen von Altruismus, die sich für das Individuum nicht lohnen. Das ist dann ein konzeptuelles Problem. Meine Vorstellung ist, dass bei den frühen Homininen nicht nur die Empathie, sondern auch das Gewissen entstanden ist. Und das ist schwierig zu erklären, denn ein Gewissen ist eine belastende Angelegenheit. Es verursacht mehr Kosten als Nutzen. Die Gewissensgeleiteten können eigentlich nicht die Gewinner der Evolution sein. Ich vermute, es hat damit zu tun, dass Eltern ihre Kinder bisweilen für den eigenen Fortpflanzungserfolg einspannen. Eine der Hauptfunktionen des Gewissens könnte darin bestehen, Familiensolidarität zu stärken. Dazu gehört Kooperationsbereitschaft und, sofern es der Familie nützt, auch Opferbereitschaft, Menschen, die ihre Ingroup schützen.
Aber ein schlechtes Gewissen hat man doch nicht nur gegenüber der eigenen Familie.
Wenn solche Mechanismen erst etabliert sind, entstehen neue Kooperationsprozesse. Die kooperative Gemeinschaft kann sich erweitern, so weit, bis nicht mehr jeder jeden kennt. So können unsere komplexen Gesellschaften entstehen, deren Grundlagen aber nach wie vor im Nahbereich liegen.
Vielen Dank für dieses Gespräch!
Zum Weiterlesen
- Eckart Voland: Soziobiologie. Die Evolution von Kooperation und Konkurrenz. Springer Verlag, Berlin, 4. Aufl. 2013
- Eckart Voland und Renate Voland: „Evolution des Gewissens“. Strategien zwischen Egoismus und Gehorsam. Hirzel Verlag, Stuttgart 2014