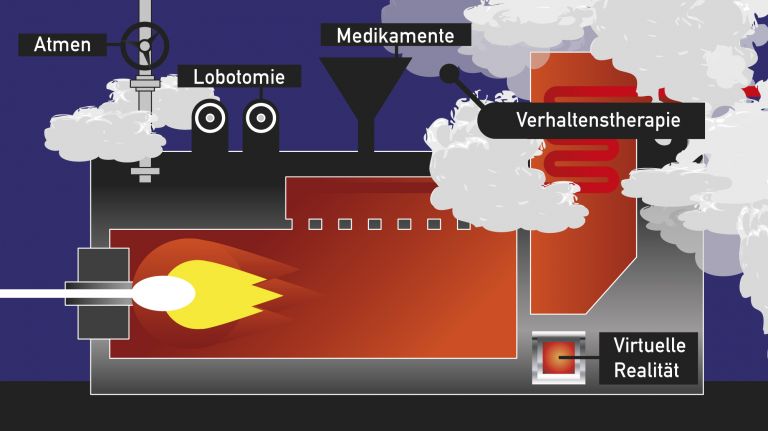Die tiefen Wurzeln der Gewalt

Aggression und Gewalt sind bis zu einem gewissen Grad Teil unserer DNA. Doch ob und wie aggressiv Menschen individuell sind, ist bekanntlich verschieden. Frühkindliche Erfahrungen und Kontrollzentren im Gehirn spielen dabei eine Rolle.
Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Andreas Reif
Veröffentlicht: 01.02.2019
Niveau: leicht
- Eine alte Streitfrage unter Philosophen lautet: Ist der Mensch von Natur aus aggressiv oder macht ihn erst die Kultur dazu?
- Für eine natürliche Veranlagung spricht, dass sich Aggressionen und Gewalt durch die Evolutionsgeschichte ziehen.
- Über Kulturen und Zeiten hinweg erweisen sich Männer als deutlich aggressiver. Nach der "Male warrior hypothesis" profitieren Männer evolutionsbiologisch von Aggression, die sie gegen Mitglieder fremder Gruppen richten: Sie ermöglicht ihnen Zugang zu Geschlechtspartnern, bringt ihnen Ressourcen und Gebietsgewinne ein.
- Manche Forscher wie Steven Pinker gehen davon aus, dass Kultur eine zügelnde Wirkung auf die Neigungen des Menschen zu Gewalt hat. Der heutige Mensch sei im Zuge diverser Zivilisationsprozesse deutlich weniger aggressiv als etwa prähistorische Jäger-und Sammler-Gesellschaften.
- Anthropologen halten dagegen, dass erst im Übergang zu Ackerbau und Viehzucht das Maß an Gewalt zugenommen habe.
- Heutige Formen von Aggressionen sind durch eine Vielzahl von Faktoren bedingt. So kann etwa früher Stress in der Kindheit Neigungen zu Aggressionen bedingen.
- Im Gehirn finden sich Hinweise, dass aggressive Menschen weniger in der Lage sind, aggressive Reaktionen zu zügeln.
Dass genetische Unterschiede die Neigung zu mehr oder weniger aggressiven Verhaltensweisen beeinflussen können, ist Verhaltensforschern und Psychiatern schon lange bekannt. Bis vor etwa 20 Jahren führte man diese Unterschiede jedoch ausschließlich auf die verschiedene Reihenfolge von Genbausteinen (Nukleotiden) zurück. Sie sollten nach dem Ablesen eines Gens durch die Maschinerie der Zelle in mehr oder weniger aktive Varianten des jeweiligen Proteins übersetzt werden. Gut untersucht ist die Monoaminoxidase-A (MAOA), ein Enzym, das gleich drei wichtige Botenstoffe des Gehirns abbauen kann. Neuere Studien zeigen, dass bei der Modulation aggressiven Verhaltens neben Varianten in der Gensequenz, auch so genannte epigenetische Änderungen eine Rolle spielen können. Einzelne Nukleotide werden dabei mit Methylgruppen markiert. Damit steuert die Zelle, ob ein Gen abgelesen wird, oder nicht. Das Verblüffende dieser epigenetischen Veränderungen ist, dass sie durch negative Erfahrungen wie Stress, Hunger oder Missbrauch angestoßen werden können. Neben dem MAOA-Gen kann beispielsweise auch jenes für den Rezeptor für das „Kuschelhormon“ Oxytocin als „Einfallstor“ für dauerhafte Verhaltensänderungen nach schlechten Erfahrungen dienen.
Was, wenn es keine Kultur gäbe? Wäre das Leben in diesem hypothetischen Naturzustand "einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz" – ein Krieg aller gegen alle? Das glaubte zumindest der englische Philosoph Thomas Hobbes (1588-1679). Menschen kämen egoistisch und bösartig auf die Welt. Erst kulturelle Regeln und soziale Einschränkungen zähmten die Bestie Mensch. Gut 100 Jahre später war der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ganz anderer Meinung. Der Naturzustand sei ein friedliches Idyll und der Mensch ein "edler Wilder". Erst die Kultur verderbe ihn.
Für Hobbes spricht auf jeden Fall, dass Aggression und Gewalt in der Evolution des Menschen eine lange Tradition haben. "Die komplexen sozialen Interaktionen zwischen Artgenossen schließen nicht nur bei Säugetieren aggressives Verhalten ein“, sagt die Neurobiologin Inga Neumann von der Uni Regensburg . „Aggression hat sich im Laufe der Evolution unter hohem Selektionsdruck als Verhaltensstrategie entwickelt.“ Eine Verhaltensstrategie, um die Chancen auf optimale Futterressourcen und auf den besten Paarungspartner zu erhöhen.
Aggressives Tun lässt sich etwa bei Schimpansen beobachten. Gruppen von Männchen bilden Koalitionen, die nicht nur die Grenzen ihres Territoriums überwachen, sondern auch benachbarte Gruppen von Artgenossen angreifen und selbst vor dem Töten nicht zurückschrecken. „Zudem spielt bei Tieren Dominanzverhalten eine entscheidende Rolle“, so Inga Neumann. „Auf diesem Weg regeln sie die Rangordnung innerhalb von Gruppen, – ein Verhalten, das insbesondere bei Primaten ausgeprägt ist.“ Auch beim Menschen geht es nicht nur im sportlichen Wettkampf um Rangordnungen. Neben der körperlichen Aggression kommt in unserer Spezies noch die verbale Aggression hinzu. „Aggressives Verhalten ist also Teil unseres genetisch determinierten Verhaltensrepertoires“, sagt Neumann.
Auffällig ist nicht nur bei Schimpansen, sondern auch beim Menschen, dass die Männer in der Gesamttendenz das aggressivere Geschlecht sind (siehe Das aggressive Geschlecht ). Organisiertes Kämpfen von Gruppen von Frauen gegen andere weibliche Gruppen findet sich in der Geschichte des Menschen kaum. Zudem sind es vor allem Männer, die über Kulturen und Zeiten hinweg, in viel stärkerem Maße unterscheiden, ob jemand zur eigenen Gruppe gehört, und damit gut behandelt wird, oder nicht. Der Evolutionspsychologe Mark van Vugt von der Universität Amsterdam geht in seiner allerdings nicht unumstrittenen " Male warrior hypothesis " davon aus, dass sich die Neigung zu kriegerischen Handlungen in der Evolution entwickelt hat. Durch Aggression zwischen Gruppen erhalten Männer Zugang zu Sexualpartnern, Gebieten, Ressourcen und erlangen einen höheren sozialen Status.
Ganz im Sinne von Thomas Hobbes wäre dem Menschen Gewalt durchaus in die evolutionäre Wiege gelegt. Das versucht auch der bekannte amerikanisch-kanadische Kognitions- und Evolutionspsychologe Steven Pinker in seinem Bestseller "Gewalt: Eine neue Geschichte der Menschheit" darzulegen. Seine überraschende These: Insgesamt habe im Laufe der Geschichte das Ausmaß der Gewalt abgenommen, insbesondere seit der Zeit der Aufklärung. Schaut man sich täglich die Nachrichten an und hat man beispielsweise das blutgetränkte 20. Jahrhundert mit seinen zwei Weltkriegen vor Augen, mag man das kaum glauben. Doch Pinkers Buch wartet mit zahlreichen Belegen aus der Ethnographie und der Paläanthropologie auf. Zudem schöpft er auch bei Zahlen und Statistiken aus dem Vollen. Demnach hätten vor allem menschliche Jäger- und Sammler-Gesellschaften zu Gewalt geneigt. Und zur Untermauerung seiner These verweist Pinker auch auf heutige Jäger-und Sammler-Gesellschaften mit hohem Gewaltpotenzial, wie die Yanomami, ein indigenes Volk im Amazonasgebiet, das tatsächlich ziemlich kriegerisch ist und das etwa feindliche Dörfer überfällt. Demnach hätten erst diverse Zivilisationsprozesse den Menschen in seinem Hang zur Gewalttätigkeit gezügelt.
Jäger und Sammler doch eher friedfertig?
Doch gerade von Seiten von Anthropologen muss Pinker immer wieder Kritik einstecken. Der Kanadier Richard B. Lee , emeritierter Professor der University of Toronto, hält dagegen, dass historische Jäger- und Sammlergesellschaften insgesamt eher friedlich waren. Sie hätten eine geringere Bevölkerungsdichte gehabt und kaum über festen Besitz verfügt, daher auch weniger Grund gehabt, sich zu streiten. Und kam es einmal doch zu Konflikten zwischen Gruppen konnte man leichter auseinandergehen und weiterziehen. Der Wandel sei erst mit der Neolithischen Revolution, im Übergang zu Ackerbau und Viehzucht gekommen: mit einer größeren Bevölkerung, festen Gebieten und Besitz, die es unter Umständen zu verteidigen galt. Erst im Zuge dieser Entwicklung seien Konflikte zwischen Gruppen angestiegen. Und auch den Verweis Pinkers auf heutige Jäger-und Sammler-Gesellschaften wie die Yanomami hält David Lee für wenig überzeugend, denn die Yanomami und andere vermeintliche Jäger- und Sammler-Gesellschaften seien in Wirklichkeit Farmer.
Doch selbst wenn Aggression und Gewalt zu einem gewissen Grad Teil unserer DNA sein sollten, ist damit noch wenig über die Mechanismen gesagt oder über den Anteil von Umwelteinflüssen wie Erziehung und Sozialisation. Warum der eine ein eher friedliebender Zeitgenosse ist, der andere aber große Lust an handfesten Auseinandersetzungen hat, wird derzeit in zahlreichen neurobiologischen, psychologischen und genetischen Untersuchungen unter die Lupe genommen. Dabei haben Forscher neben genetischen Einflüssen insbesondere das frühe soziale Umfeld als maßgeblichen Faktor im Visier (Kasten). Inga Neumann, die Regensburger Neurobiologin, verweist auf Tierstudien zu frühem Lebensstress. „Wenn man Jungtiere für täglich ein bis drei Stunden von ihrer Mutter trennt, bringt das bei ihnen einen höheren Level an Aggression mit sich." Derartige negative Erfahrungen regulierten zum einen langfristig die Aktivitäten fest verdrahteter neuronaler Bahnen des Gehirns, die aggressive Reaktionen steuern wie Teile der Amygdala, Bereiche des Hypothalamus und Thalamus oder das Belohnungszentrum – der Nucleus accumbens. „Zum anderen steuern genetische und epigenetische Einflüsse auch Regionen des Kortex, der für die hemmende Kontrolle aggressiver Verhaltensmuster verantwortlich ist.“
Empfohlene Artikel
Außer Kontrolle
Die Klinische Neuropsychologin Kerstin Konrad von der Uniklinik Aachen untersucht im Rahmen des internationalen Graduiertenkollegs IRTG 2150 den Zusammenhang zwischen kognitiver Kontrolle und aggressiven Reaktionen. Zunächst hat sie mit Kollegen in einer noch unveröffentlichten Metaanalyse geschaut, inwieweit impulsive Reaktionen, die eher kognitiv gesteuert sind, im Gehirn mit Aggressionen zusammenhängen. Ist also jemand besonders aggressiv, wenn er sich schlecht kognitiv kontrollieren kann? „Tatsächlich findet man starke Überlappungen zwischen aggressiven Impulsen und kognitiver Kontrolle“, sagt Kerstin Konrad.
„Areale, die bei Aufgaben zur kognitiven Kontrolle anspringen, befinden sich eher auf der rechten Hirnhälfte.“ Es handele sich um ein Netzwerk von frontalen und striatalen Arealen. „Und auch bei aggressiven Reaktionen sind zum Teil die gleichen Areale aktiv, wenn auch auf beiden Seiten des Gehirns.“ Die stärkste Überlappung finde sich in der vorderen Inselregion als einer Schaltstelle zwischen kognitiven und emotionalen Systemen. „Darauf aufbauend schauen wir uns jetzt im Scanner den Einfluss von Testosteron sowohl auf kognitive Kontrolle als auch auf aggressive Reaktionen an.“ Schließlich ist schon länger bekannt, dass das Sexualhormon zu Aggressionen und antisozialem Verhalten führen kann .
Wenn Aggression krankhaft ist
Zudem untersucht Konrad Menschen, bei denen Probleme mit Aggressionen Teil einer psychischen Krankheit sind. Dabei hat sie vor allem auch Mädchen im Blick. Im Schnitt haben zwar Männer ein größeres Aggressionspotenzial. Sie sind auch stärker vertreten in der Gruppe der Psychopathen und der Gewaltstraftäter. „Andererseits gibt es die Vermutung, dass Frauen Aggressionen einfach nur anders äußern“, sagt Kerstin Konrad. „Dass sie beispielsweise eher verbal als körperlich aggressiv agieren.“ Beim Cybermobbing etwa tun sich auch Frauen hervor, und offenbaren ihre aggressiven Seiten. Zudem gibt es Mädchen, die unter Störungen des Sozialverhaltens leiden, und soziale Regeln nicht anerkennen bzw. nicht einhalten. Sie sind oft aggressiv, haben Wutausbrüche oder streiten häufig. Solche Störungen kommen zwar seltener vor als bei Jungs. Aber wenn sie aufträten, sei es eine Störung mit hohen Kosten und einer starken Inanspruchnahme von Hilfe, so Kerstin Konrad. Interessanterweise fanden Konrad und ihre Kollegen heraus, dass die Gehirne von Jungs und Mädchen sich dabei kaum unterscheiden. „Beide Gruppen zeigen große Störungen in der Emotionsverarbeitung.“ Die Hoffnung ist natürlich, dass diese Erkenntnisse in wirksame Therapien münden (siehe Strategien gegen Gewalt). Denn: Auch wenn Aggressionen aus Sicht der Evolution oft sinnvoll waren, so sind sie heute zum gesellschaftlichen Problem geworden.
Zum Weiterlesen:
- Palumbo Set al: Genes and Aggressive Behavior: Epigenetic Mechanisms Underlying Individual Susceptibility to Aversive Environments. Front Behav Neurosci. 2018 Jun 13;12:117. doi: 10.3389/fnbeh.2018.00117. eCollection 2018.
- Pinker, Steven: Gewalt: Eine neue Geschichte der Menschheit. Fischer, Frankfurt 2011