Wie Stress im Kopf dem Herzen schadet
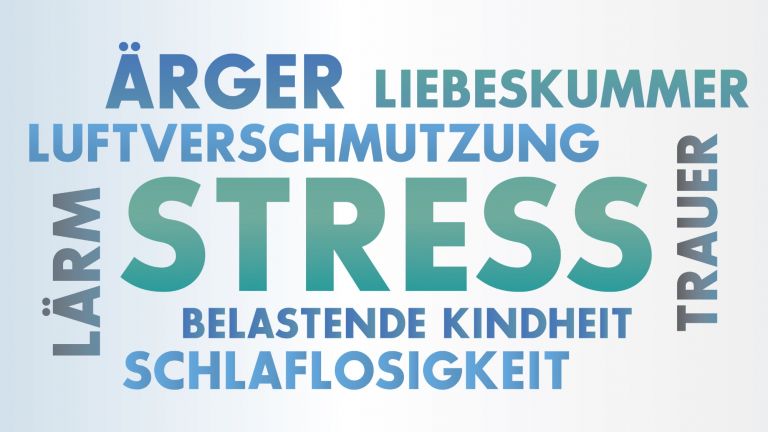
Ob Stress, Schlafmangel oder Trauer – Gehirn und Herz reagieren gemeinsam – und empfindlich – auf Stressfaktoren. Mit schädlichen Wirkungen für unsere Gesundheit. Entspannungstechniken können helfen.
Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Erik M. Müller
Veröffentlicht: 11.10.2022
Niveau: leicht
- Stress am Arbeitsplatz geht mit einem deutlich erhöhten Risiko für Vorhofflimmern einher. Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen.
- Ganz allgemein können starke Emotionen, die unsere Psyche belasten, auch unserem Herzen zusetzen. So etwa Trauer.
- Mit starken negativen Gefühlen haben Menschen zu kämpfen, die als Kinder Traumata, Missbrauch, Vernachlässigung erlebt haben. Bei ihnen ist die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls deutlich erhöht.
- Chronische Schlafprobleme gehen mit erhöhtem Risiko für Herzversagen einher.
- Menschen, die regelmäßig meditieren, haben ein geringeres Risiko für koronare Herzerkrankungen.
Sollen wir auf unseren Kopf hören oder auf unser Herz? Die Frage ist oft die gleiche – egal, ob es um Liebesdinge geht oder um die Berufswahl. Wenn aber Stress, Trauer oder Schlafmangel zu unseren Dauerbegleitern werden, sollten wir auf beide Organe hören. Sie bilden die neurokardiologische Achse. Was wie eine Kopfsache wirkt, die uns psychisch zu schaffen macht, wirkt sich neben dem Gehirn sehr stark auf das Herz aus. Beide Organe reagieren empfindlich. Mit gefährlichen Folgen, wenn man nicht auf sie hört und gegensteuert.
„Ich bin ziemlich im Stress“. Dieser Satz fällt in der heutigen Zeit ständig. Tatsächlich fühlen sich viele Menschen vor allem beruflich unter Druck: drängende Deadlines, Videokonferenzen im Akkord oder drei Jobs auf einmal. Im Rahmen einer Studie hat sich die Epidemiologin Eleonor Fransson von der Jönköping University mit Kollegen Arbeitsstress angeschaut. Unter Arbeitsstress verstehen die Forscher hohe psychische Anforderungen bei gleichzeitig geringer Kontrolle über die Arbeitssituation. Beispiele sind Fließbandarbeiter, Busfahrer, Sekretärinnen und Krankenschwestern. Die Studie ergab: Stress am Arbeitsplatz ging mit einem um fast 50 Prozent höheren Risiko für Vorhofflimmern einher. Vorhofflimmern ist eine Herzrhythmusstörung. Dabei schlägt das Herz anhaltend unregelmäßig und oft so schnell, dass es weniger Blut in den Körper pumpt. Vorhofflimmern ist nicht unmittelbar lebensbedrohlich, es erhöht aber das Risiko, dass sich Blutgerinnsel bilden. Damit steigt auf Dauer auch die Gefahr, einen Schlaganfall zu erleiden.
Trauerfälle und verlorene Fußballspiele
Die Redewendung vom „gebrochenen Herzen“ weist darauf hin, dass starke Emotionen auch unserem Pumporgan zusetzen können. Dabei ist die Trauer, die man beim Verlust eines geliebten Menschen empfindet, wohl eines der stärksten negativen Gefühle überhaupt. Sie kann gleich für den nächsten Todesfall sorgen. In einer Studie britischer Wissenschaftler zeigte sich: Nach dem Tod des Partners hatten Menschen im Alter von 60 Jahren und älter innerhalb von 30 Tagen ein mehr als doppelt so hohes Risiko für einen Schlaganfall oder Herzinfarkt wie Menschen, die keinen solchen Verlust erlitten hatten. Zwar ist nicht auszuschließen, dass es systematische Unterschiede gibt zwischen Versuchspersonen mit und ohne Partnerverlust. So könnte es sein, dass ältere Menschen, die gerade ihren Partner verloren haben, auch vorher schon weniger gesund waren als gleichaltrige Personen, deren Partner noch lebt. Die Forscher haben aber versucht, diese Unterschiede in ihre Berechnungen einzubeziehen und glauben, dass ein besseres Verständnis der Zusammenhänge neue Möglichkeiten der Vorbeugung eröffnen könnte.
Der Beitrag des Gehirns besteht darin, dass sich unter Trauer die Verdrahtung der grauen Zellen derart verändern kann, dass sein Besitzer in einer permanenten Stressreaktion gefangen wird. Stresshormone strömen durch den Körper. Das Herz beginnt zu rasen, der Blutdruck steigt, die Atemfrequenz erhöht sich. Auf Dauer ist das nicht gut für unser Pumporgan.
Was die Auswirkungen auf das Herz angeht, so kann die Trauer um einen geliebten Menschen erstaunlicherweise ähnliche körperliche Folgen nach sich ziehen, wie das verlorene Spiel der Lieblingsmannschaft im Fußball. Echte Fans nehmen sich solch einen Verlust sprichwörtlich zu Herzen, wie Kardiologen der Universität Bialystok in Polen berichten . Schlechte Ergebnisse der örtlichen Profifußballmannschaft fielen in deren Untersuchung mit mehr Fällen von akutem Koronarsyndrom bei Männern zusammen. Dabei handelt es sich um Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit starker Verengung oder sogar dem Verschluss eines Herzkranzgefäßes. Dazu zählen auch Herzinfarkte. Möglicherweise kann der mentale und emotionale Stress einer Niederlage Herzinfarkte auslösen. Beim Anschauen von Sportereignissen komme es zu einer erhöhten Aktivierung des Sympathikus und der Stresshormonachse, schreiben die Forscher. Der Sympathikus ist Teil des autonomen Nervensystems, das bei Stress anspringt. Allerdings gibt es auch Studien, die keinen Zusammenhang zwischen Niederlagen beim Fußball und Herzerkrankungen gefunden haben. Das letzte Wort zu dem Thema ist also noch nicht gesprochen.
Eine Niederlage der Lieblingsmannschaft sorgt vor allem kurzfristig für schlimme Gefühle. Langfristig überschwemmt mit negativen Gefühlen werden hingegen Menschen, die als Kinder Traumata, Missbrauch oder Vernachlässigung erlebt haben. Bei Menschen, die in ihrer Kindheit den größten Belastungen im familiären Umfeld ausgesetzt waren, war die Wahrscheinlichkeit eines kardiovaskulären Ereignisses wie eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls während einer 30-jährigen Nachbeobachtungszeit um mehr als 50 Prozent erhöht. Das ergab eine Studie von Forschern der Northwestern University in Chicago um den Mediziner Jacob Pierce . Die Wissenschaftler nehmen an, dass die schlimmen Erfahrungen aus der Kindheit die Fähigkeit beeinträchtigen, die Gefühle regulieren zu können. Dies befördere außerdem die Ausbildung von Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Rauchen, Angstzustände, Depressionen und Bewegungsmangel, die bis ins Erwachsenenalter andauern können.
Schlaganfall
Schlaganfall/Apoplexia cerebri/stroke
Bei einem Schlaganfall werden das Gehirn oder Teile davon zeitweilig nicht mehr richtig mit Blut versorgt. Dadurch kommt es zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff und dem Energieträger Glukose. Häufigster Auslöser des Schlafanfalls ist eine Verengung der Arterien. Zu den häufigsten Symptomen zählen plötzliche Sehstörungen, Schwindel sowie Lähmungserscheinungen. Als Langzeitfolgen können verschiedene Arten von Gefühls– und Bewegungsstörungen auftreten. In Deutschland ging 2006 jeder dritte Todesfall auf einen Schlaganfall zurück.
Empfohlene Artikel
Gefährlicher Schlafmangel
Negative Gefühle, die uns keine Ruhe lassen, können uns regelrecht um den Schlaf bringen. Und es mehren sich die Hinweise, dass verschiedene Schlafprobleme an Herzversagen beteiligt sind. Eine große Beobachtungsstudie mit Daten von mehr als 400.000 Personen untersuchte den Zusammenhang zwischen gesunden Schlafmustern und Herzversagen. Zur Messung der Schlafqualität gehörten die Schlafdauer, Schlaflosigkeit und Schnarchen. Außerdem interessierte die Wissenschaftler, ob die Teilnehmer Frühaufsteher oder „Nachteulen“ waren, und ob sie tagsüber schläfrig waren. Das Ergebnis: Gesunde Schlafgewohnheiten waren mit einem geringeren Risiko für Herzversagen verbunden. Erwachsene mit den gesündesten Schlafgewohnheiten, die morgens aufstehen, 7-8 Stunden pro Tag schlafen und nicht häufig unter Schlaflosigkeit, Schnarchen oder übermäßiger Tagesmüdigkeit leiden, waren klar im Vorteil. Bei ihnen war das Risiko für Herzversagen um 42 Prozent geringer als bei Personen mit ungesunden Schlafgewohnheiten.
Luftverschmutzung und Lärm gehen aufs Herz
Während der Schlafmangel sein unrühmliches Werk leise tut, kommt ein anderer Stressfaktor für Herz und Gehirn umso lauter daher: Verkehrslärm. In einer Studie mit den Daten von 4,4 Millionen Schweizern fand man einen Anstieg des Herzinfarkt-Risikos um bis zu 3,4 Prozent mit jeder Zunahme des Lärms um 10 Dezibel. Die Studie ergab auch, dass Menschen, die sowohl Luftverschmutzung als auch Lärm ausgesetzt sind, das höchste Risiko für einen tödlichen Herzinfarkt haben. Die Auswirkungen von Luftverschmutzung und Lärm summieren sich also auf. „Was Luftverschmutzung und Lärm als Stressor für Herz und Gehirn angeht, ist die Datenlage noch sehr dünn“, sagt Jens Litmathe, Facharzt für Herzchirurgie-, Intensiv- und Notfallmedizin am Evangelischen Krankenhaus Wesel, der zur neurokardiologischen Achse geforscht hat. „Es liegt auf der Hand, dass sie für die neurokardiologische Achse nicht gut sind. Aber was hier im Detail passiert, ist noch nicht erforscht.“
Auch wenn die genauen Ursachenketten vielfach noch im Dunkeln liegen, eines ist jetzt schon klar. Wir sollten den verschiedenen Stressoren für Gehirn und Herz gegensteuern. Ideal wäre es womöglich, in eine „bessere Gegend“ zu ziehen. Aber es gibt auch zahlreiche Methoden, die uns helfen, zu entspannen und psychisch und körperlich widerstandsfähiger zu werden: ob Achtsamkeitstraining, Progressive Muskelentspannung oder Meditation. In einer US-amerikanischen Studie zeigte sich, dass Menschen, die meditierten, seltener an hohem Cholesterinspiegel, hohem Blutdruck oder Diabetes litten. Sie hatten seltener einen Schlaganfall oder eine koronare Herzkrankheit als diejenigen, die nicht meditierten. Der größte Unterschied bestand bei der koronaren Herzkrankheit. Diejenigen, die per Meditation entspannten, hatten im Vergleich ein um rund 50 Prozent geringeres Risiko, daran zu erkranken. Hören wir also auf unseren Kopf und unser Herz, und fahren die Stressfaktoren runter. Die beiden Organe werden es uns danken.
Zum Weiterlesen
- Fransson EI, Nordin M, Magnusson Hanson LL, Westerlund H. Job strain and atrial fibrillation - Results from the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health and meta-analysis of three studies. Eur J Prev Cardiol. 2018 Jul;25(11):1142-1149. (zum Abstract ).
- Krittanawong C, Kumar A, Wang Z, Narasimhan B, Jneid H, Virani SS, Levine GN. Meditation and Cardiovascular Health in the US. Am J Cardiol. 2020 Sep 15;131:23-26. doi: 10.1016/j.amjcard.2020.06.043. (zum Abstract )



